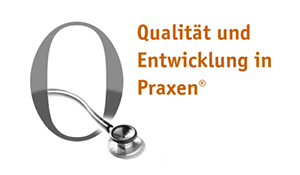Das Krankheitsbild
Die Pathologie
Die lumbale Spinalkanalverengung oder Spinalkanalstenose ist eine der häufigsten Erkrankungen der Wirbelsäule vor allem im fortgeschrittenen Lebensalter.
Die Entstehung einer Spinalkanalstenose liegen entweder rein degenerative Veränderungen oder eine Kombination aus kongenitalen (angeborenen) und degenerativen Veränderungen zugrunde. Eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung der Spinalkanalstenose nimmt dabei die altersabhängige fortschreitende Bandscheibendegeneration im Verlauf des Lebens ein. Vermutlich liegt auch hierfür eine gewisse genetische Prädisposition vor. Zudem begünstigen äußere Faktoren wie Übergewicht, Inaktivität oder Fehlbelastungen ursächlich den degenerativen Verschleiß der Wirbelsäule. Durch den zunehmenden Höhenverlust der Bandscheibe kommt es zu Protrusionen (Bandscheibenvorwölbung) und damit zu einer Mehrbelastung der Wirbelgelenke vor allem beim Zurückbeugen (Extension).
Daraus resultiert wiederum eine Vergrößerung (Hypertrophie) der Facettengelenke (Spondylarthrose) mit Verdickung der Gelenkflächen und der Gelenkkapsel. Im weiteren kommt es auch zu einer Verdickung des Ligamentums flavum, welches den Spinalkanal abdeckt. Dies wird zusätzlich zu einer Spinalkanalverengung zusammen mit den oben beschriebenen knöchernen Veränderungen.
Häufig kommt zu einer Spinalkanalstenose eine degenerative Spondylolisthesis hinzu, d.h. ein degenerativ bedingtes Wirbelgleiten des oberen Wirbelkörpers über den unteren nach vorne. Die degenerative Spondylolisthesis ist meistens mit einer konsekutiven zentralen Spinalkanalstenose vergesellschaftet.
Symptome
Bei mehr als 80% der Patienten lässt sich anamnestisch ein Rückenschmerz eruieren, die meisten berichten, dass Rückenschmerzen seit langer Zeit vorhanden sind und zumindest einen gewissen Anteil an dem Gesamtbeschwerdebild hat. Das eindeutige Leitsymptome einer degenerativ bedingten Spinalkanalstenose ist jedoch die Claudicatio spinalis. Hierbei handelt es sich um ein Symptom, dass durch eine verminderte symptomfreie Gehstrecke und Stehzeit, einer raschen Ermüdung der Beine beim Gehen, Schweregefühl, muskelkaterartigen Beschwerden und durch ausstrahlende Schmerzen mit Taubheits- und Kribbelgefühl in den Beinen charakterisiert ist.
Natürlicher Verlauf der Symptome
Es gibt keine weitreichenden Studien zu diesem Thema. Es wurde bisher nicht untersucht wie der Spontanverlauf, d.h. ohne operative Behandlung, also nur konservativ mit Schmerzmedikation, einer degenerativ bedingten Spinalkanalstenose ist.
Was jedoch feststeht: In einem Zeitraum von ca. 2-4 Jahren kommt es nach dem ersten Auftreten der typischen Symptome bei der überwiegenden Zahl der Patienten zu keiner Veränderung, also keinerlei Besserung, bzw. sogar zu einer Verschlechterung der Beschwerden mit abnehmender Mobilität und Gehstrecke oder Zunahme der Schmerzen.
Behandlung der Spinalkanalstenose
Bildgebung
Die heutige Bildgebung bei V.a. eine lumbale Spinalkanalstenose ist sehr vielfältig. An erster Stelle steht die Kernspintomographie inklusive Upright- und Funktionskernspintomographie in der Aussagekraft. Die nervalen Strukturen und knöchernen Strukturen werden sehr exakt wiedergegeben und somit kann eine eindeutige Diagnose erhoben werden. Zudem steht das Funktionsröntgen und die Computertomographie (CT) zu Verfügung, um die Morphologie (durch knöcherne Veränderungen, ligamentäre Veränderungen, Bandscheibenveränderungen), die Lokalisation (zentrale Stenose, recessale Stenosierung, foraminale Stenose), die Ausdehnung (wie viele Etagen und Höhen der LWS) und funktionelle Veränderungen (Deformität, Skoliose, Instabilität) sehr genau zu bestimmen. Dies ermöglicht eine detaillierte Planung der Therapie.

Mikroinvasive – topographische Diagnostik
Bei Patienten mit verschiedenen Schmerzfromen bei einer lumbalen Spinalkanalsteose (ausstrahlende Schmerzen = radikulär, Rückenschmerzen) ist die genaue topographische Fokussierung auf die Schmerzquelle wichtig, um z.B. einen eventuellen operativen Eingriff auf das Nötigste reduzieren zu können. Die mikroinvasive CT-gesteuerte Schmerztherapie mit Infiltrationen können hierbei helfen, eine Differenzierung des Schmerzes zu erreichen, d.h. ist er durch die Facettengelenke, durch die Bandscheibe oder durch eine funktionelle Veränderung (Instabilität) bedingt. Die CT-gesteuerten Infiltrationen erlauben neben einem therapeutischen Effekt also eine topographische Diagnostik.
Anästhesie und Narkoseverfahren
Überwiegend betrifft die Erkrankung der Spinalkanalstenose Patienten im fortgeschrittenen Lebensalter. Die Spinalkanalstenose ist typischerweise eine Erkrankung, die sich im 7. bis 8. Lebensjahrzehnt manifestiert und symptomatisch wird. Dies bedeutet, dass die Patienten häufig Komorbiditäten wie arterielle Hypertonie, Herzerkrankungen, Stoffwechselstörungen (Diabetes mellitus) oder Einschränkung der Lungenfunktion aufweisen. Der Fortschritt im Bereich der Narkose und Anästhesiologie erlauben zunehmend sichere Operationen auch bei älteren und vorerkrankten Patienten.
Erwartung der Patienten
Die erheblich verbesserten Lebensumstände vor allem in den westlichen Industrieländern haben zu einer gesteigerten Lebenserwartung geführt und somit zu zunehmend älteren Patienten in gutem geistigen und körperlichen Zustand. Die Erwartungshaltung der Patienten ist deshalb sehr hoch an die Behandlung ihrer degenerativ bedingten Spinalkanalstenose mit Wiederherstellung der vorher ebenfalls ausgeübten Tätigkeiten auch sportlicher Tätigkeit.
Das Alter der Patienten, die Dauer der Symptome und Art der Beschwerden, sowie Vorerkrankungen, operatives und anästhesiologisches Risiko, aber auch die Erwartung des Patienten sind die wichtige Grundlage für eine differenzierte therapeutische Zielsetzung.
Operationstechnik
Die immer weiter voranschreitende Verbesserung und Optimierung in der Medizin, hat auch zur Verbesserung der operativen Techniken in der Behandlung der Spinalkanalstenose geführt und nachhaltig verändert. Die Dekompression der neuralen Strukturen (also der Nerven in der Wirbelsäule) ist heutzutage mit den sogenannten mikrochirurgischen Verfahren möglich. Hierdurch kann die Hautsymptomatik bei der Spinalkanalstenseo wirksam angegangen werden. Die Behandlung der häufig assoziierten Rückenschmerzen erfordert meist das Hinzuziehen von korrigierenden und stabilisierenden Maßnahmen.
Therapieoptionen und Ergebnisse bei der Spinalkanalstenose
Konservative Therapie
Die alleinige konservative Therapie bei der Spinalkanalstenose, d.h. ohne operative Behandlung, ist umstritten. Die degenerativ bedingten Veränderungen der Wirbelsäule und die Verengung des Kanals an sich werden durch die konservative Behandlung nicht zurückgedreht. Die Langzeiteinnahme von nichtsteroidalen Antirheumatika, Muskelrelaxanzien, die Verwendung von Steroiden und Antidepressiva sowie die Einnahme lang wirksamer Opiate werden kritisch diskutiert. Zudem führt eine verlängerte konservative Therapie dazu, dass die später gestellt Indikation zur Operation, dann nicht mehr die guten Ergebnisse bringt, da schon neurologische Ausfälle vorliegen oder Komorbiditäten des Patienten erschwerend hinzugetreten sind und auch das anästhesiologische Risikoprofil beeinflussen. Manifeste neurologische Defizite, die auch schon in Ruhe vorliegen, bilden sich meist auch mit einer Operation nicht mehr zurück. Zudem führt die Immobilisierung der Patienten zu einer Steigerung der sekundären Komplikationen.
Eine konservative Behandlung der Spinalkanalstenose ist nur dann sinnvoll, wenn eine später erfolgende Operation hierdurch nicht negativ beeinflusst wird oder das Operationsrisiko einfach viel zu hoch ist. Es gibt Studien über die konservative Behandlung der Spinalkanalstenose (Schmerzmediaktion, Physiotherapie, Injektionen/Infiltrationen an der Wirbelsäule) die zeigen, dass nach 2 Jahren nur bei einem Drittel der Patienten eine gewisse Verbesserung ihrer Beschwerden und Lebensqualität eingetreten ist.
Insgesamt zeigt die Studienlage, dass die Schmerzen bei einer Spinalkanalstenose durch Gabe von Paracetamol oder Calcitonin einer Placebogabe vergleichbar sind. Prostaglandine und Gabapentin haben keinerlei Einfluss auf die Gehstrecke der Patienten. Die wichtigste Säule der konservativen Therapie vor allem beim älteren Menschen ist die intensive physiotherapeutische Behandlung mit Muskel entspannenden Maßnahmen und Stärkung der Rückenmuskulatur zum Erhalt von Funktion und Mobilität. Lokale Injektionen (Facetteninfiltrationen, epidurale Lokalanästhesie/Steroidinjektionen) können im Einzelfall hilfreich sein, wissenschaftlich belegt ist die Wirkung solcher Maßnahmen trotz mehrerer Studien nicht. Für die Therapien mit Krankengymnastik, Ruhigstellung der Wirbelsäule, Haltungsschulung, Orthesen liegen keine ausreichenden Daten vor, die eine Wirksamkeit belegen.
Letztendlich ist die operative Therapie bei der richtigen Indikationsstellung und Abwägung des individuellen Risikoprofils der konservativen Therapie signifikant überlegen, was Besserung der Lebensqualität und Linderung der Beschwerden anbetrifft. In mehreren Studien, teilweise mit über 600 Patienten, konnte ein signifikant besseres Ergebnis nach der operativen Behandlung gezeigt werden.
Zusammenfassung
Es kann zusammenfassend gesagt werden, dass es für die konservative Therapie bei der lumbalen Spinalkanalstenose eigentlich keinen relevanten Wirkungnachweis gibt. Lediglich die operative Therapie, und dies ist wissenschaftlich eindeutig untermauert, hat eine positive und nachhaltigeWirkung auf die Symptomatik bei einer Spinalkanalstenose.
Operative Behandlungsoptionen
Das Ziel der Operation bei einer Spinalkanalstenose ist die ausreichende Freilegung also Dekompression des Nervenkanals. Zudem kann die Dekompression der Nervenaustrittslöcher (Foramen intervertebrale) erforderlich sein. Dieses kann mit unterschiedlichen Verfahren realisiert werden.
Direkte offene mikrochrirugische Dekompression
Die weitaus effizienteste operative Therapie ist die direkte offene Dekompression des Spinalkanals. Diese erfolgt mikrochirurgisch und erhält dadurch meist die Stabilität des Bewegungssegments bei ausreichender suffizienter Entlastung und Erweiterung des Spinalkanals. Dabei erfolgt ein interlaminärer Zugang zunächst auf einer Seite mit Freilegung und Dekompression der Dura (Cauda equina) und des Recessus lateralis. Die Laminektomie oder Hemilaminektomie sind meist nicht mehr indiziert oder angewendet, da deutlich invasiver und häufig hierdurch Verstärkung einer bestehenden Instabilität.
Nach Freilegung der einen Seite, wird in der cross-over Technik, oder Undercutting genannt, unter dem Dornfortsatz auf die Gegenseite geschaut und dort ebenfalls der Recessus dekomprimiert. Der Vorteil der Undercutting-Technik ist darin zu sehen, dass nur ca. 30-40 % des auf der Zugangsseite gelegenen Facettengelenks operativ reduziert werden muss. Die Gegenseite bleibt in puncto Facettengelenk, Muskulatur praktisch unberührt. Dies soll die Dekompression unter Erhalt der Stabilität in diesem Segment ermöglichen.
Indikationsstellung und Ergebnisse der operativen Dekompression
Das Verfahren der klassischen Dekompression mit Undercutting zur Gegenseite kann bei allen Formen der lumbalen Spinalkanalstenose verwendet werden. Bei voroperierten Patienten allerdings kann das Undercutting sehr erschwert sein und Risiken der Nervenhautverletzung bedingen, da es zu Vernarbungen im Zugangsbereich kommt. In diesem Fall muss eventuell eine beidseitiges Vorgehen erfolgen.
Bei Operationen in mehreren Etagen kann das sogenannte „Slalomprinzip“ verwendet werden, d.h. man dekomprimiert abwechselnd von den verschiedenen Seiten, man wechselt von Höhe zu Höhe also die Seite. Mehr als 3 Segmente zu dekomprimieren macht jedoch meist keinen Sinn.
Die Dekompression mit der Undercutting Technik bei Spinalkanalsteosen ist das Standardverfahren in der Wirbelsäulenchirurgie. Das Ziel der Therapie ist immer die Freilegung und Druckentlastung von nervalen Strukturen. Die besten Ergebnisse werden daher bei Patienten erzielt, die im Vordergrund stehende Schmerzen in den Beinen haben (Claudicatio), auch wenn als ein gewisser Nebeneffekt dieser Methode bei bis zu zwei Dritteln der Patienten eine Abnahme der meist assoziierten Rückenschmerzen (Lumbago) zu beobachten ist.
Zusammenfassung
Die direkte offene, mikrochirurgische (mit Operationsmikroskop) Dekompression bei einer lumbalen Spinakanalstenose gilt als das effizienteste Verfahren mit reproduzierbar zufriedenstellenden Ergebnissen. Die klinischen Ergebnisse sind in Studien mit mehreren hundert Patienten gut und die Reoperationsrate, d.h. die Notwendigkeit für eine erneute Dekompression in der selben Höhe, ist sehr gering. Das Verfahren ist nicht auf bestimmte Formen der Spinalkanalstenose limitiert, jedoch sind die Ergebnisse nicht so überzeugend bei Patienten mit im Vordergrund stehenden Rückenschmerzen oder manifester Instabilität in dem Segment, welchen zudem stenosiert ist.
Lumbale Spinalkanalstenose mit im Vordergrund stehenden Rückenschmerzen
Bei nahezu allen Patienten mit einer Spinalkanalstenose sind Rückenschmerzen vorhanden. In den meisten Fällen bestehen assoziiert zu den Beschwerden in den Beinen (Claudicatio spinalis) Rückenschmerzen, welche bei der überwiegenden Zahl der Patienten mehr als 1 Jahr besteht. Meist ist der Rückenschmerzen eher ein Begleitsymptom und ist von der Wertigkeit her für den Patienten sekundär. Überwiegt aber der Rückenschmerz die durch die Stenose verursachte Symptomatik (Lumboischialgien, Schmerzen in den Beinen, Schaufensterkrankheit, Gehstreckenminderung), so muss dies unbedingt in die Planung der Therapie/Operation mit einfließen.
Entscheidend ist die Ursache des Rückenschmerzes. Morphologisch ist dies hauptsächlich die Arthrose der kleinen Wirbelgelenke (Facettengelenke) und/oder die Degeneration der Bandscheibe in der Höhe der Spinalkanalstenose.
In mehr als der Hälfte der Patienten führen die morphologischen Gefügestörungen sowohl zur Rückenschmerzgenese als auch aggravierend erst recht zur Manifestation einer Spinalkanalstenose. Dabei typische bildmorphologische Veränderungen sind die degenerative Spondylolisthesis und die degenerative Skoliose der Lendenwirbelsäule.
Operative Ergebnisse

Ob der dominante Rückenschmerz bei einer Spinalkanalstenose nach einer Operation und Dekompression besser wird, ist in mehreren Studien untersucht worden.
Bei einer signifikanten Zahl der Patienten ohne Kurvaturstörungen oder einer Instabilität kommt es zu einer Verbesserung des Rückenschmerzes. Hingegen zeigen Patienten mit gleichzeitig vorliegenden Instabilitäten oder Kurvatur-/Gefügestörungen nach alleiniger Dekompression deutlich schlechtere Ergebnisse.
Die Kombination aus Dekompression und gleichzeitiger Stabilisierung gilt weiterhin als der „Goldstandard“ bei Patienten mit Spinalkanalstensoe und Kurvaturstörung oder Instabilität und im Vordergrund stehendem Rückenschmerz. Die Gesamterfolgsraten bei diesem kombinierten Vorgehen liegen bei 70-80%, bei der degenerativ bedingten Spondylolisthesis sogar etwas höher.
Behandlungsalgorithmus der lumbalen Spinalkanalstenose
Beinschmerz
Claudicatio spinalis
Claudicatio spinalis
Milde bis moderate Stenose
Schwere Stenose
Rückenschmerz
Schwere der Symptomatik
erhöhtes altersbedingtes Anästhesierisiko
subjektive Lebensqualität
eingeschränkt
Keine Instabilität
Behandlung
Modifikation der täglichen Aktivitäten
Physiotherapie Schmerzmedikation bei Bedarf